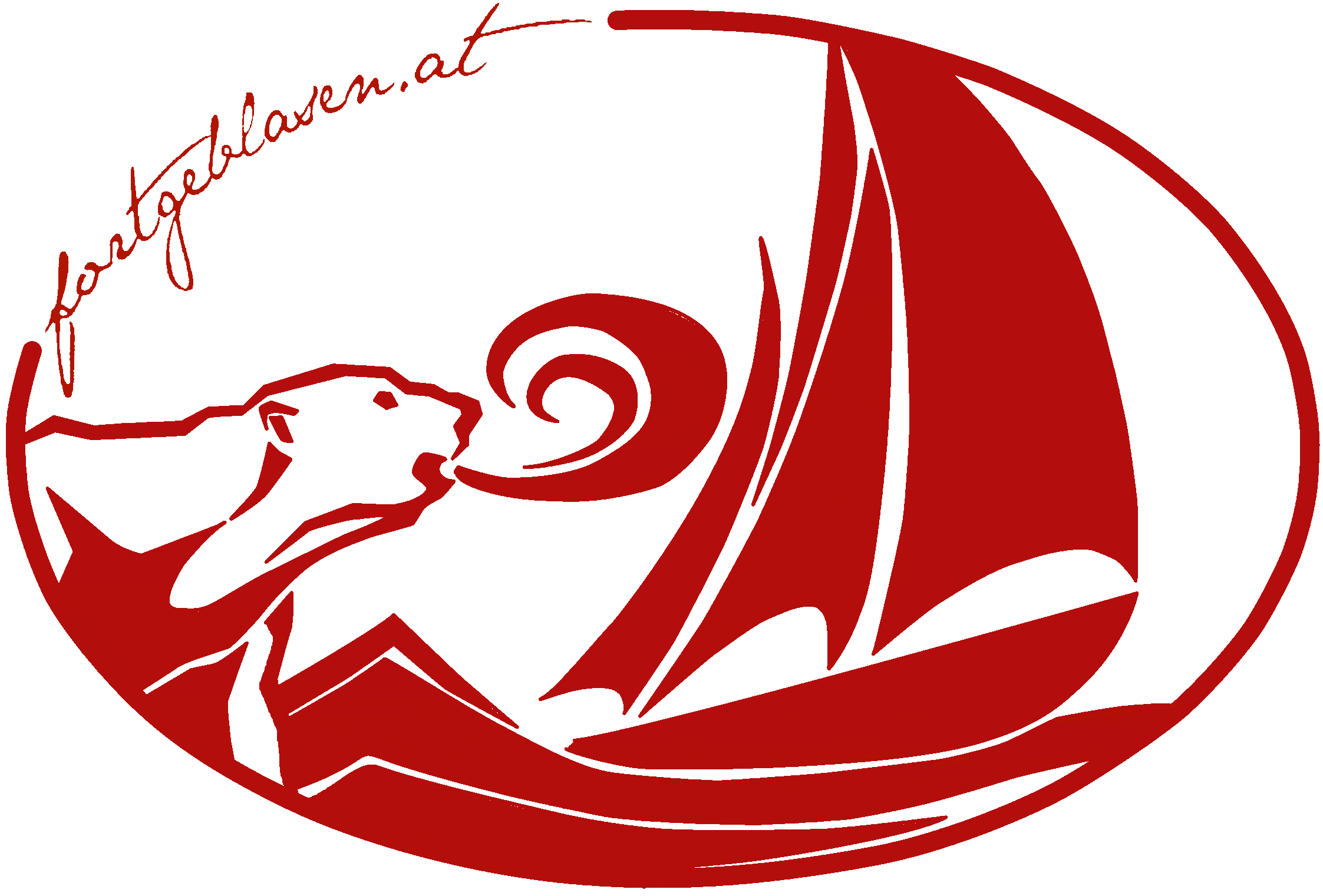Der warme Passatwind füllt die Segel und lässt die Yacht über den tiefblauen Ozean gleiten, während im Cockpit die Bananen in der Sonne reifen und die Crew im Schatten des Bimini den Blick über den Horizont wandern lässt. Sanft hebt und senkt die lange Woge des Pazifiks das Segelboot, voller Lebensfreude spielen Delfine in der Bugwelle. Vorerst kaum zu erkennen, dann mehr und mehr Form annehmend, taucht eine sattgrüne Insel am Horizont auf. Immer deutlicher werden die Palmkronen, die sich leicht im Wind wiegen, bald kommt der helle, weiße Sandstrand in Sicht, der die tropische Insel umgibt. Vorsichtig segelt die Yacht durch den Pass im Riff in die blaugrüne Lagune, zieht einen Kreis dicht unter der sandigen Küste und lässt den Anker ausrauschen. Still und friedlich liegt die Yacht in der hellen Bucht, zur Feier der Ankunft wird mit einem kühlen Cocktail angestoßen. Leise rauscht der leichte Wind in den Palmwedeln und die Brandung der See am Aussenriff schlägt den Tackt während sich ein erstes Auslegerkanu vom Strand löst in dem Insulaner lachend Trinknüsse und Blumen zur Begrüssung der segelnden Besucher bringen. Segeln in der Südsee eben…
So oder ähnlich stellen sich die meisten Menschen wohl das Segeln im Südpazifik vor. Und was für ein verlockendes Bild das wohl sein muss, wenn man mitten im grauen Alltag zwischen Arbeit und Verantwortung steckt. Zugegeben, hin und wieder, wenn auch selten, kommt es der Wirklichkeit sogar nahe. Dann wundert man sich sogar fast darüber, weshalb mindestens zwei Drittel der Yachtcrews, die wir bisher in der Südsee getroffen haben, davon träumen, ihre Yacht spätestens in Neuseeland oder Australien zu verkaufen und zurück nach Hause fliegen zu können. Zurück zur Familie, zum Job und zum Leben im Alltagstrott. Dann erstaunt es einen, weshalb so viele Yachten an den einsamen und schönen Buchten vorbei ziehen, um möglichst schnell den nächst größten Hafen zu erreichen um dort so lange wie möglich am Steg eines kleinen Yachthafen zu liegen. Um dort ihre Wunden zu lecken und ihre Ersatzteile zu empfangen. Um bei Pizza und WiFi den letzten Segelschlag zu vergessen und die nächste Inseltour zu organisieren, während der Regen aufs Deck trommelt.
Denn hier im Südpazifik ist der Passat nur eine der gängigen Wettererscheinungen und bald schon hat man über eine ganze Menge weiterer Begriffe vom lokalen Wetter gelernt, die allesamt wenig beliebt bei Yachtcrews sind: Da gibt es die „Intertropical Convergence Zone“ und die „South Pacific Convergence Zone“ , da gibt es „Trough“, „Reach“ und „Shear Line“. Da ist das „Frontal Band“ mit seinem ausgedehnten Regen, die „Quasi-stationary Front“, die gefährliche „Squash Zone“ zwischen den im Süden unaufhaltsam dahin marschierenden Tiefs und Hochs und nicht zu vergessen die großen Gespenster von „El Niño“, „Tropical Depressions“ und „Tropical Zyclones“. Letztere zwei hoffen die meisten Segler wenigstens durch das schnelle Weitersegeln innerhalb der richtigen Saison zu entgehen. Und über die „Maximum Cloudiness“ und die fast ständigen „Rough Seas“ wollen wir Paradiessegler erst garnicht sprechen.
Bald schon lernt die Crew, trotz schwüler Hitze mit geschlossenen Luken zu segeln, um die überkommende See oder den nächsten Regenguss draußen zu halten. Man gewöhnt sich daran, die dahinziehenden Wolkenwalzen misstrauisch im Auge zu behalten, um nicht wieder mit voller Segelfläche von der nächsten Starkwindböe erwischt zu werden. Und bald schon wird es zur angenehmen Überraschung, sollte man auf der nächsten Etappen einmal nicht von einer rauen Kreuzsee empfangen werden.
Vielleicht ist es ja Zufall, vielleicht aber auch nur Segler-Alltag, dass im verregneten Bora-Bora nur noch selten eine Yachtcrew von der „Barfuß-Route“, dem „Coconut Milk Run“ spricht. Viel mehr kreisen nun die Gespräche um die einzelnen Etappen, die vorm Bug liegen. Da gibt es die „Gefährliche Mitte“ – die sich zwischen Französisch Polynesien und Tonga streckt. Und auch wenn der Name der Etappe gar übertrieben ist, ungemütlich sind die über tausendzweihundert Seemeilen wohl allemal. Denn hier darf zwischen unzähligen Regen- und Windböen auf der nördlichen Route und wechselhafteren Winden, schwereren Kreuzseen und denkbar schlechten Ankerplätzen an den paar Inseln auf der südlicheren Route gewählt werden.
Und was kommt nach der „gefährlichen Mitte“? Für viele Blauwassercrews liegt dann die bisher anspruchsvollste Etappe ihrer Segellaufbahn vor dem Bug: Die Neuseeland-Etappe. Schon seit Französisch Polynesien geistert das große Gespenst der Neuseeland-Etappe unter den Seglern herum, sofern es sich nicht um Yachten handelt, die rasch weiterziehen und anstelle Neuseelands und einem eventuell zweiten Jahr in der Südsee den Weg weiter in den Westen wählen. Ende Oktober, rechtzeitig vor Beginn der Zyklonsaison in der Südsee, muss der Törn ins wechselhafte Frühlingswetter Neuseelands unternommen werden und es heißt, dass jede Yacht mindestens mit einem Frühlingssturm entlang ihrer Reise in den Süden rechnen sollte. Kein Wunder, dass da viele Crews nervös werden, nachdem sie bereits entlang den bisher einfachen Etappen ihrer Blauwasserlaufbahn Bruch und Pannen erlebt haben.
Richtig. Bruch und Pannen. Denn mittlerweile sind wohl die meisten Yachten weit genug gereist, um herauszufinden, dass viele Teile ihrer Yacht und ihrer Ausrüstung eigentlich für den Wochenende- und Urlaubssegler gefertigt wurden. Löchrig gescheuerte Segel, Ankerwinden mit sich auflösenden Kunststoffteilen, gebrochene T-Terminals im Rigg, kaputte Wassermacher, warme Kühlschränke und natürlich Autopiloten, die ihren Dienst verweigern. Und nach all den gesegelten Meilen zeigt die eine oder andere Kunststoffyacht ihre ersten Überbelastungen: neue, knackende oder krachende Geräusche verursachen dem einen oder anderen Bootseigner ein Unbehagen, während andere ihr Rigg nicht mehr durchsetzen können. Und wenn die Laune auf dem Tiefpunkt ist, ist auch noch die Luft aus dem Dingi raus und der Aussenborder will nicht laufen.
Aber gut, die wenigsten „Yachties“ sind nur zum Segeln und Reparieren hier her gekommen. Immerhin gibt es ja paradiesische Inseln, die zwischen den Segeletappen liegen. Paradiesische Inseln, die allerdings nur wenige vorgefertigte Highlights für geborene Konsumenten bieten. Und so werden die Ankerplätze bei den Resort-Cocktailbars als die schönsten erkoren. So wird im Versuch die Natur zu konsumieren den Delfinen mit den Dingis nachgejagt, bis sie sich mit ihren frisch geborenen Jungen nicht mehr in die Bucht wagen. Während zweitägigen Stops werden die Inseln via „Inseltour“ im Schnellverlauf erkundet und leichte Endtäuschung wird laut, dass die Urbevölkerung mit Handis herumläuft, anstelle mit Einbaum-Auslegerkanus durch die Buchten zu segeln.
Halt… Stop! Soll dass den plötzlich heissen, dass die Südsee nicht mehr das ist, was sie verspricht? Keine Sorge. Dieses riesige Ozeanien zu besegeln füllt sicherlich jeden Kopf mit Eindrücken. Das Leben in der Südsee geht immer noch seinen ruhigen Gang. Noch heißen die Einheimischen uns Segler herzlich willkommen, laden uns in ihre Hütten und zum Essen ein und zeigen stolz ihre Art zu leben, solange wir uns auch die Zeit dafür nehmen.
Wer die Freiheit der Einfachheit sucht wird auch heute auf vielen Inseln sein kleines Paradies auf Erden finden. Doch wer hat den Seglern vorgegaukelt, dass es dieses Paradies umsonst zu finden gibt? Warum glauben intelligente Menschen, sich auf den größten aller Ozeane ohne Anstrengung und Risiko bewegen zu können? Wie kommt es, dass in der Südsee Segler unterwegs sind, die vor dem Bruch des Autopiloten ihre Yacht noch niemals von Hand gesteuert haben? Dass wir Segelcrews treffen, die zu faul sind, um Nachtwachen zu fahren und lieber die Yacht sich selbst überlassen, während sie acht Stunden durchschlafen? Das manche Bordfrauen tausende Seemeilen zurücklegen, ohne den blassesten Schimmer zu bekommen, wie Segel getrimmt werden? Das wir Skipper in der Südsee treffen, die noch niemals eine Wetterkarte studiert haben?
Und wie kommt es, dass Menschen erwarten, einen Blick ins Paradies werfen zu können, indem sie jene Liste an Touren abarbeiten, die ihnen der letzte Cruising Guide und der neueste Lonley Planet vorgegeben haben? Bis zu einem Ausmaß, dass eine gewisse Bar in Bora-Bora oder der Besuch eines Perlengeschäfts zu den unvergesslichen Highlights des Südsee-Segelns gekoren werden! Müssen wir denn wirklich erst auf einer geführten Schnorchel-Tour Schildkröten füttern, um die Tierwelt hier erlebt zu haben? Sind wir denn wirklich schon so effizient von Werbung und Konsumwelt erzogen worden, dass wir die Ironie an dem Versuch, die Südsee zu konsumieren nicht mehr sehen können?