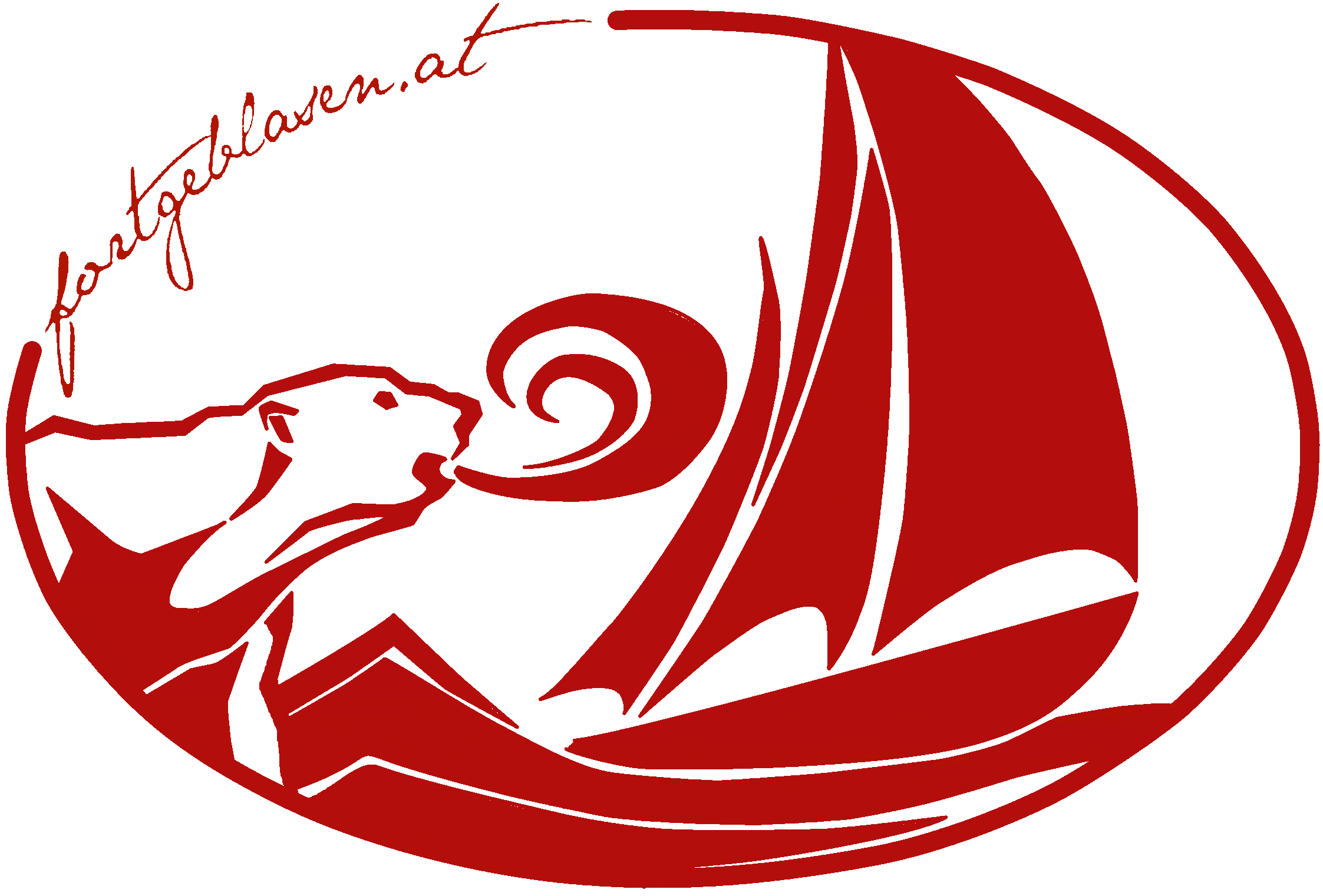Eine außergewöhnliche Seereise im Südmeer
Eine außergewöhnliche Seereise im Südmeer
Das neue Buch und der letzte Teil einer Weltumsegelung rund um den amerikanischen Kontinent
Vor über einem Jahrzehnt sind die beiden Hochseesegler Claudia und Jürgen zu ihrer epischen Reise aufgebrochen. Nun liegt der abenteuerlichste Ozean der Welt vorm Bug ihrer Expeditionsyacht: das Südmeer. Von Neuseeland führt die Reise durch die „Brüllenden Vierziger“ bis nach Südamerika, wo sie einen magischen Winter in den Kanälen von Patagonien verbringen. Im folgenden Sommer wagen Claudia und Jürgen ein besonderes Abenteuer. Sie lassen Kap Horn im Kielwasser und segeln über die gefährliche Drake Passage, um drei Monate im Eis der Antarktis zu verbringen. Dort beschließen sie, den Atlantik in seiner vollen Größe kennezulernen. Sie segeln von der Antarktis bis nach Europa: Transatlantik der Länge nach und besuchen dabei die entlegensten Inseln des Atlantiks.
Auch als Kindel ebook erhältlich:
Als Leseprobe hier ein Auszug aus dem neuen Buch!
Im Meer der Widersprüche
 Graue Schleier verbergen schwer und nass jede Sicht. Noch ist es früh am Morgen auf den Falklandinseln, kein Lufthauch ist zu spüren. Trotzdem haben wir gegen sechs Uhr die Leinen gelöst und tuckern nun aus der weitläufigen Bucht von Stanley Hafen. Unser Zeitfenster, die Küste von Westfalkland zu erreichen, ist knapp. Neunzig Seemeilen bis zur geplanten Ankerbucht liegen vor uns, aber der Wetterbericht warnt bereits für die frühen Morgenstunden der kommenden Nacht vor stürmischem Westwind. Wir haben keine Zeit zu vertrödeln und schieben den Gashebel nach vorne!
Graue Schleier verbergen schwer und nass jede Sicht. Noch ist es früh am Morgen auf den Falklandinseln, kein Lufthauch ist zu spüren. Trotzdem haben wir gegen sechs Uhr die Leinen gelöst und tuckern nun aus der weitläufigen Bucht von Stanley Hafen. Unser Zeitfenster, die Küste von Westfalkland zu erreichen, ist knapp. Neunzig Seemeilen bis zur geplanten Ankerbucht liegen vor uns, aber der Wetterbericht warnt bereits für die frühen Morgenstunden der kommenden Nacht vor stürmischem Westwind. Wir haben keine Zeit zu vertrödeln und schieben den Gashebel nach vorne!
Schlechtes Gewissen macht sich in uns breit. Wie ärgerlich, dass wir schon zu Beginn dieser Reise auf den mageren Dieselvorrat an Bord zurückgreifen. Wir werden voraussichtlich in den kommenden Monaten bis in die Antarktis und zurück keine Gelegenheit haben, erneut Diesel zu bunkern.
Um La Belle Epoque für ihre gefährliche Reise nicht zusätzlich mit Gewicht zu belasten, haben wir darauf verzichtet, ergänzend Kanister voll Diesel an Bord zu nehmen. Das Boot ist ohnehin schon überladen. Die Reise vor uns erlaubt keine weiteren Einbußen der Seetüchtigkeit.
Sowohl der verstaute Proviant als auch das Propangas und der gebunkerte Diesel müssen für den Südsommer reichen. Ein kalter Sommer, in dem wir durch eine der unbarmherzigsten Wasserwege der Welt – der Drake Passage südlich von Kap Hoorn – kreuzen und über Monate in den kalten Gewässern der Antarktis verbringen werden. Es werden Monate sein, in denen wir Diesel nicht nur für den Motor benötigen – um schwere Tiefdrucksysteme zu umfahren, zwischen Eisbergen zu navigieren oder in unvermessene Ankerbuchten zu manövrieren. Der an Bord mitgebrachte Diesel muss uns durch die Kälte der Antarktis bringen und als Heizmaterial für unseren treuen Dieselofen dienen. Jeder Tropfen, den wir hier auf den Falklandinseln verschwenden, wird uns später fehlen. Auf der Strecke voraus gibt es keine Möglichkeit, die Tanks zu füllen, es sei denn, wir legen einen Zwischenstopp in Chile ein. Eine Alternative, die wir nicht zu nutzen gedenken.
Doch einen Umweg haben wir in die Reise vor uns eingeplant: Wir werden nicht auf direktem Weg in die Antarktis ziehen, sondern vorab die Falklandinseln umrunden. Es sind Inseln, die kaum von Segelyachten besucht werden. Inseln, auf denen die Menschen in „Camps“ wohnen und die Brutkolonien von Albatrossen und Pinguinen beheimaten. Die Falklands haben unsere Neugier geweckt.
Es ist ohnehin noch zu früh in der Saison, um sofort in die Antarktis aufbrechen zu können. Und da wir keine Lust haben, länger in der windverwehten Bucht von Port Stanley zu warten, gehen wir auf falkländische Entdeckungsfahrt.
Eine kaum spürbare Brise zeichnet Muster auf die farblose Wasserfläche, sofort gehen die Segel hoch. Der Wind nimmt schlagartig zu. Sobald unsere stählerne Lady ihr volles Segelkleid trägt, ist es Zeit, einen Teil der Segel zu streichen und zu reffen. Was mit Motorkraft in der Flaute beginnt, endet fünfzehn Stunden später unter vierfach gerefftem Großsegel und der Arbeitsfock bei stürmischem Wind.
In Tamar Pass gräbt sich der Anker tief in den Schlamm. Ich bin froh, der von Wind und Strömung aufgewühlten See entkommen zu sein.
Die Falklandinseln sind flach, es gibt keine Bäume. Nichts schützt vor dem fauchenden Wind entlang der Küste. Die Wälder dieser Insel liegen unter Wasser: Wälder aus Seetang, die über viele Meter in die Höhe wachsen und die Buchten füllen. Tang, der seine dunkelgrünen Blätter faul in der Dünung schwenkt, der das Echolot zu sinnlosen Angaben verführt und jeden Anker auf die Probe stellt.
Der neue Wetterbericht meldet für die nächsten Tage einen ausgewachsenen Orkan aus West mit Winden bis 11 Beaufort. In diesen Tang-Teppichen wollen und können wir uns nicht auf unseren Anker alleine verlassen. Stunden, nachdem der Anker ausgebracht ist, lichten wir ihn daher wieder. Es wird Zeit, La Belle Epoque orkansicher zu verholen.
Vorsichtig tasten wir uns so nahe wie möglich unter die Küste vor, bis wir mit dem gewählten Platz zufrieden sind. Wir setzen den ersten Anker. Jürgen steht am Bug und lässt die Kette langsam ausrauschen, belegt sie anschließend am stählernen Poller. Ich gebe vorsichtig rückwärts. Sobald die Kette steif kommt, erhöhe ich nach und nach die Drehzahl. Vom Bug kommt Jürgens Handzeichen: Alles ok – der Anker hält. Ich kann den Motor auf Leerlauf stellen. Sobald die Kette entlastet ist, nimmt Jürgen sie erneut vom Poller, um mehr und mehr Ankertrosse ausrauschen zu lassen.
In der Zwischenzeit steuere ich das Boot quer zum ersten Anker, gehe erneut dicht unter Land. Das ist der heikle Teil unseres Ankermanövers. Eine falsche Einschätzung, und die gesteckte Ankertrosse verfängt sich in der laufenden Schiffsschraube. Das könnte sowohl den Bootsantrieb verklemmen als auch den Anker ausreisen. Vor aufkommendem Sturm ein gefährlicher Fehler!
Mein Blick bleibt am Echolot, während Jürgen vom Bug aus den Verlauf der Ankertrosse beobachtet und vorsichtig meine Fahrt dirigiert. Dann kommt mein Handzeichen an ihn: Alles ok – wir sind dicht genug an Land – lass den Anker fallen! Sofort rauscht der zweite Anker aus. Ich lasse das Boot rückwärts treiben, während Jürgen die Kette des Zweitankers steckt. Die Gefahr ist gebannt, nun kann sich die Ankertrosse nicht mehr in der Schiffsschraube verfangen. Der zweite Anker muss eingefahren werden, dann holt Jürgen die Trosse des Hauptankers bis zum Beginn der Kette. Anschließend werden noch beide Ankerketten ordentlich belegt und gesichert.
Anschließend stelle ich den Motor aus und La Belle Epoque liegt beinahe bewegungslos hinter ihren in V ausgebrachten Ankern. Aber mit dem Setzen der zwei Buganker ist die Arbeit nicht getan. Nun müssen die Landleinen ausgebracht werden.
Mit Hilfe des Vorsegelfalls heben wir gemeinsam das Dingi von Bord. Jürgen springt ins Gummiboot und zieht sich rückwärts zum Heck, wo ich ihm das Ende der Schwimmtrosse reiche. Mit etwas Mühe paddelt er durch den dicken Seetang-Teppich, die grüne Schwimmtrosse in schlepp. Er erreicht einen großen Felsbrocken am Ufer und befestigt sein Ende der Trosse daran. Ich bringe in der Zwischenzeit das bordseitige Ende zum Bug, ziehe es durch ein Stück Feuerwehrschlauch und durch die Klüse. Der Feuerwehrschlauch wird die Trosse davor bewahren, in der Klüse zu scheuern. Schließlich hole ich die Trosse dicht, bis mir die Kraft ausgeht, und belege sie auf einer weiteren stabilen Klampe. Fertig. La Belle Epoque liegt sicher an drei Punkten verholt. Wir werden keine Heckleine benötigen, da ohnehin keine Winddrehungen prognostiziert sind und wir daher nicht davon ausgehen, dass sich La Belle über ihre Anker dreht.
Die nächsten Tage versinken im Heulen des Windes. Wir liegen sicher wie in Abrahams Schoß und haben nichts weiter zu tun, als auszuharren. Dicht unter Land und im schützenden Teppich des Seetangs, bleibt das Wasser bewegungslos, nur der Wind drückt beharrlich auf die Masten, singt und heult und lässt La Belle Epoque abwechseln nach Backbord und nach Steuerbord wanken. Wir liegen mit Büchern in den Händen im Boot, vertreiben uns die Zeit mit Schreiben oder sehen Filme. Hin und wieder stecken wir die Köpfe aus der Luke, huschen übers Deck und kontrollieren die Ketten und Trossen. Auch solche Tage gehören in diesen windgepeitschen Reviere dazu!

Tage später ziehen wir weiter, segeln durch die „Nordwest Passage“ der Falklandinseln und stoppen in der einen oder anderen Ankerbucht. Die Buchten sind weitläufig, dem Wind ausgesetzt und nur von flachem, unspektakulärem Land umgeben.
Erneut treffen wir die Santa Maria Australis. Auch sie hat sich nach Westfalklands begeben. Schade, dass wir keine Ankerbucht teilen, ein gemeinsames Abendessen wird deshalb auf ein Treffen in der Antarktis verschoben. Vorausgesetzt, wir laufen uns dort unten über den Weg.
Durch den Pebble Sund müssen wir ein letztes Mal auf unseren Dieselvorrat zurückgreifen. Selbst nach tagelangem Warten will der Wind nicht mit uns kooperieren. Zwischen den niedrigen Inseln pfeift entweder steifer Westwind gegen uns, oder der Wind schläft einfach ein. Doch dann ändert sich das Wetter. Leichter Wind füllt die Segel, fröhlich bunt glitzert das warme Sonnenlicht am Wasser, das Land duftet förmlich nach Frühling und Sommer.
Zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit können wir die isolierten Overalls im Schapp hängen lassen. Wir stehen in Pantoffeln und Pullover im Cockpit, saugen die Energie der Sonnenstrahlen mit jeder einzelnen Zelle unserer Haut auf. Sanft wiegt sich La Belle Epoque unter den ausgebreiteten Segeln. Ein paar Pelzrobben spielen entlang der Küste. Ein Augenblick, der die vielen harten Seemeilen im Kielwasser vergessen lässt.
Dann huschen ein paar Pinguine durch die Bugwelle. Die Strömung wird intensiver und ich kurble hart am Ruder, um La Belle zwischen die Felsküsten der Inseln zu manövrieren. Wir erreichen den vortrefflichsten Stopp auf den Falklandinseln: Westpoint Island.
Die kleine Insel am äußeren Rand der Falklands wird von einem sympathischen Paar bewohnt. Bei Kaffee und Kuchen erfahren wir mehr vom Leben außerhalb der Siedlungen. Für die Farmer hier draußen ist mittlerweile das Geschäft mit dem Tourismus einträglicher als die Schafhaltung geworden. Abby und Rick erzählen uns, dass in dieser Saison fünfzig Kreuzfahrtschiffe erwarten, die einen Stopp auf Westpoint Insel einlegen werden. Gegen eine geringfügige Gebühr wird die einsame Schaffarm zum Erlebnisschauplatz, inklusive Farmbesichtigung, Kaffee und Kuchen, sowie einer Wanderung zum Albatros-Felsen.
Die Brutkolonie der Albatrosse hoch über den Klippen an der Außenseite der Insel zieht uns ebenso magisch an. Die Albatrosse sind nicht alleine, unter ihren aufgetürmten Nestern nisten besonders possierliche Geschöpfe: Die „Kleinen“ unter den Pinguinen – die Felsenspringer Pinguine – haben rote Augen und drollige gelbe Federn, die wie buschige Augenbrauen abstehen. Sie genießen Schutz bei den Albatrossen. Hier wagen weder Skuas noch Sturmvögel, die Eier oder Jungen der Pinguine zu rauben.
Gegen die größte Gefahr, die den Felsenspringer Pinguinen zur Zeit droht, sind aber auch die majestätischen Albatrosse machtlos: gegen die Hitze. Erbarmungslos brennt die Sonne auf die Brutkolonie herunter und den armen Pinguinen steht die Verzweiflung in den Gesichtern geschrieben. Selbst wir als Beobachter können ahnen, wie sehnlich sich die Tiere um diese Tageszeit im kalten Nass des Ozeans verstecken möchten, doch die Pflicht und der Instinkt verhindern derart frevelhafte Elternschaft. So werden die Eier wiederholt „gelüftet“, es wird gehechelt und gefächelt, um die grausame Hitze des beginnenden Sommers zu ertragen. Einige der Tiere werden diese Frühlingshitze nicht überstehen und im Versuch, ihre Eier zu beschützen, den Hitzetod finden.
 Meine eigenen Empfindungen könnten nicht unterschiedlicher zu denen dieser Pinguine sein. Nach dem Winter in Patagonien fühle ich mich, als hätte ich mein halbes Leben auf wärmende Sonnenstrahlen gewartet. Mir scheint, als kenne ich nur noch schreiende Winde, nasse, kalte Tage die einem bis in die Knochen schmerzen. Jede Zelle meines Körpers schreit nach Sonne, Wärme, Trockenheit. Die Tatsache, dass diese warmen Tage nur ein kurzes Zwischenspiel sind, dass wir uns auf dem Weg in die Antarktis befinden und uns dem Frühling bald freiwillig entziehen, ist kaum zu ertragen.
Meine eigenen Empfindungen könnten nicht unterschiedlicher zu denen dieser Pinguine sein. Nach dem Winter in Patagonien fühle ich mich, als hätte ich mein halbes Leben auf wärmende Sonnenstrahlen gewartet. Mir scheint, als kenne ich nur noch schreiende Winde, nasse, kalte Tage die einem bis in die Knochen schmerzen. Jede Zelle meines Körpers schreit nach Sonne, Wärme, Trockenheit. Die Tatsache, dass diese warmen Tage nur ein kurzes Zwischenspiel sind, dass wir uns auf dem Weg in die Antarktis befinden und uns dem Frühling bald freiwillig entziehen, ist kaum zu ertragen.
Wie verlockend wäre es, hier im gleißenden Sonnenlicht, den Bug einfach in den Norden zu drehen. Eine Woche segeln, und wir würden die schwersten Systeme hinter uns lassen. Eine einzige, kurze Woche, und wir könnten barfüßig auf Deck herumlaufen und eine Leichtigkeit verspüren, wie sie nur die warmen Passatwinde auf ein Segelboot hauchen können.
Wer oder was zwingt uns eigentlich, den Bug in den Süden zu drehen? Wer verdammt uns dazu, mit aller Kraft den harten Weg gegen den Wind zurück bis zur argentinischen Staateninsel zu kämpfen, nur um den Schrecken aller Seefahrer zu Gesicht zu bekommen: Die Drake Passage?
Niemand.
Niemand zwingt uns zu einer Reise in den Süden. Niemand, außer wir selbst. Wir haben keine Sponsoren, keine Verträge, keine Chartergäste oder Mitsegler. Wir haben keine Verpflichtungen gegenüber irgendjemandem – mit Ausnahme gegenüber uns selbst. Es gibt keine Erwartungen von außen, die uns unorthodoxe Reisen befehlen können. Kritisch frage ich mich: Ist aus meiner Veröffentlichung unserer Reisepläne über Internet eine Verpflichtung für uns erwachsen? Wollen wir wegen falscher Gründe das kalte Abenteuer Antarktis starten? Ja, will ich denn überhaupt dort hin? Wo bleibt meine Vorfreude? Sollte ich nicht längst darauf brennen, endlich Bestätigung für freies Wasser von den Eiskarten zu haben und in den Süden zu starten?
Abends spreche ich mit Jürgen über meine Gedanken. Und erfahre, dass auch er eine harte Zeit hat, hier „umzudrehen“. Nein. Es sind nicht Verpflichtungen oder aufgesetzte Gründe, die uns zu einer Reise in den fernen Süden bewegen. Es ist nur unsere Neugierde, unser Abenteuergeist, die immer noch heiße Liebe zur Natur. Unsere Entdeckungslust hat uns noch nicht verlassen. Vermutlich würden wir es uns nie verzeihen, drehten wir hier und jetzt den Bug in den Norden.
Es sind nur zwei Kleinigkeiten, die uns unbedeutende Zweifel ins Ohr flüstern: Zum einen ist es die Tatsache, dass wir schon ziemlich lange unterwegs sind und hin und wieder das alte Europa vermissen. Und zum anderen ist es der Respekt, den wir trotz aller Erfahrung vor den wahrlich gefährlichsten Seerevieren dieser Welt haben. Man könnte auch sagen, es ist das Wissen, was vor uns liegt.
Denn vor uns liegt Schwerwetter, Anstrengung, Seekrankheit. Vor uns liegen harte Segeltage, lausige Ankerplätze und der Kampf mit Eis und Fallwinden. Und wir wären gewiss Übermenschen, würden wir keine Überwindung benötigen, um diese Gespenster von uns zu streifen.
Dazu kommt, dass sich der Kurs von den Falklands in den Süden wie eine Umkehr anfühlt, nachdem wir ein Stück weit in den Norden gesegelt sind und ein paar Tage laues Frühlingswetter genießen. Im gemeinsamen Gespräch lösen sich die Zweifel so schnell auf, wie sie gekommen sind. Nachdem wir unsere Gedanken ausgesprochen haben, fallen die Anstrengungen der Vorbereitung von uns ab und endlich stellt sich Vorfreude ein.
Beaver Insel wird der letzte Stopp unserer Falkland-Rundreise. Hier lernen wir Jerome Pochet kennen, eine Ikone der französischen Segelwelt und „Urvater“ aller Yachtreisen in die Antarktis. Was für ein Kontrast, die Familie der Extremsegler bei ihren jährlichen Farmarbeiten anzutreffen: Kurzerhand helfen wir einen Nachmittag beim Schafscheren mit.
Dann gibt der Wetterbericht mehr oder minder grünes Licht. Vorausgesetzt, man erwartet sich in diesem Seerevier nicht allzu viel. Wir wollen keinen Diesel verschwenden, deshalb ist eine Wettervorhersage, die vierzig Knoten Halbwind prophezeit, eben gut genug. Ein nüchterner Eintrag ins Logbuch spricht mehr als alle Beschreibungen:
Sehr raue Ausfahrt bei Gegenstrom zwischen Beaver Insel und Weddell Insel. Auch draußen bleibt die See rau, müssen hart am Wind halten. 3 Reffs und Fock. SEHR seekrank!
Zweihundertfünfundzwanzig Seemeilen später laufen wir erschöpft und bei Dunkelheit in den östlichsten Fjord der Staateninsel ein. Die Seekarten sind ungenau und die massive Strömung um die Insel erschwert die Einfahrt. Doch mit Hilfe von Radar, Mondlicht und vereinter Konzentration meistern wir auch diese Fahrt. Bei fünfzehn Meter Wassertiefe geht endlich der Anker auf Grund und wir staunen über die Schönheit dieser unberührten Insel. Eine Schönheit, die wir im Augenblick mehr mit unserer Nase erahnen können, denn das Mondlicht beleuchtet nur schemenhaft eine unberührte Wildnis. Aber der Wald um uns verströmt einen betörenden Duft.
Auf unserer Fahrt um die Falklandinseln haben wir nicht zuviel Diesel verbraucht. Deshalb fällt nun unsere Entscheidung: Wir werden keinen Umweg über Puerto Williams in Chile fahren. San Juan del Salvamento auf den Staateninseln wird unser letzter Halt vor der Drake Passage bleiben. Nächster Stopp: Antarktis!